
Es war ein Zufall, dass 1850 bei Wallerfangen ein umfangreicher Hortfund der späten Urnenfelderzeit (um 800 v. Chr.) zutage kam. Als beim Kartoffelausmachen die Hacke in ein Bronzeschwert sauste, war das der leicht verunglückte Auftakt zu einer überaus glücklichen Entdeckung. Der herbeigerufene Grundstückseigner verständigte die Leiter der Steingutfabrik Villeroy & Boch in Wallerfangen, Barthélémy Sthème de Jubécourt und Auguste Jaunez, und die beiden Herren hoben den Schatz und zeichneten ihre Beobachtungen auf. Über Jaunez‘ Schwager, den Metzer Juristen und Altertumsforscher Victor Simon, gelangten alle 65 Bronzegegenstände nach Saint Germain en Laye in das 1867 gegründete Musée des Antiquités nationales, wo noch heute im Bronzezeitsaal das „dépôt de Vaudrevange“ zu den Glanzstücken der Ausstellung zählt. Aus dem Fundensemble sticht ein Gegenstand hervor, den Victor Simon 1852 als crepitaculum publiziert hatte, und der in der modernen Literatur als tintinnabulum geführt wird: ein Gebilde aus Metallscheiben, die, aneinandergeschlagen, einen Klang hervorbringen. Das Tintinnabulum besteht aus einer großen, mit konzentrischen Kreisrillen verzierten Ringscheibe, einem daran radial angefügten, profilierten Stab mit Ösenenden und zwei kleineren Ringscheiben, die an der inneren Öse des Radialstabs hängen. Die beiden kleinen Scheiben sind Miniaturen der großen.
Solche Instrumente sind selten. Man kennt sie nur von der französischen Atlantikküste bis ins Rhein-Main-Gebiet. Soweit durch Beifunde datierbar, stammen sie aus der späten Urnenfelderzeit. Ein Verbreitungsschwerpunkt liegt im Saarland und im benachbarten Lothringen, wo die meisten vollständigen Exemplare gefunden wurden.
Schon als Kind hat sich Stefan Michelbacher aus Wallerfangen, Jahrgang 1971, für den Fund begeistert, den er damals bloß aus der Literatur kannte. Er wollte wissen: Was ist das für ein Instrument? Ob es wirklich klingt? Und wie genau es sich dann wohl anhören mag? Als Erwachsener hat er 2018 diese Fragen wieder aufgegriffen und einer Antwort zugeführt. Dazu hat er ein „Double“ des rätselhaften Instruments zum experimentellen Gebrauch nachgebaut. Um beste Voraussetzungen für authentischen Gebrauch zu gewährleisten, sollte das neu zu fertigende Artefakt dem bronzezeitlichen in Material, Form, Maßen und Gewicht so nahe wie möglich kommen.
In rund 26 Stunden handwerklicher Arbeit schuf St. Michelbacher, mit Fräs- und Dreharbeiten unterstützt von Metallmeister Sebastian Ehrhard, eine Replik des Tintinnabulums. Als Ausgangsmaterial wählte er Bronzeronden mit 6% Zinnanteil und Stäben mit 8% Zinn, was den Legierungen des Originals sehr nahe kommt. Weil er sich der Kosten wegen auf vorgegebene Industrienormen beziehen musste, sind die Ringscheiben der Replik geringfügig dicker als die des Originals. Bei den kleinen Scheiben mit 85 mm Durchmesser sind es 2,0 mm statt 1,8 mm, bei der 284 mm großen Hauptscheibe 2,5 mm statt 2,2 mm. Dadurch dürfte die Replik insgesamt ca. 150−200 g schwerer sein als das Original im ursprünglichen Zustand, ohne Korrosionsverluste.

St. Michelbacher beschreibt die Fertigung der Replik in verschiedenen Stufen bis hin zur „Hochzeit“ der Einzelteile am 21. Juni 2018 wie folgt: Auf vorgefertigten Bronzeronden wurden die tiefen Rillen der Verzierung auf einer Karussell-Drehbank 0,6 mm tief eingefräst, die feineren Feldrillen mittels eines alten Schallplattenspielers als Drehscheibe und der Korundspitze einer Bohrmaschine. Das Fensterloch auf der 6-Uhr-Position der Hauptscheibe wurde mit einer hydraulischen Lochstanze (25,4 mm) ausgestanzt und mit einem HSS-Kegelsenker nachbearbeitet.
Das Stabmaterial wurde im Bohrfutter einer Standbohrmaschine eingespannt und mit Bügelsäge und Schlüsselfeilen bearbeitet. Für das Finish kamen die üblichen Schleifmittel (Schmirgelpapier verschiedener Körnungen, Lamellenschleifer, Stahlwolle) zum Einsatz.
Zum Zusammenfügen der Teile wurden Silberlot (L-Ag40Sn, 875 °C) und Messinglot (L-CuZn40, 625 °C) verwendet, um bei verschiedenen Löttemperaturen die Fügung der Komponenten in zwei Fertigungsstufen zu ermöglichen. Kleine Korrekturen und Füllungen wurden mit Zinn-Kupferlot (Sn60Pb38Cu2, 285 °C) durchgeführt.
Schon während der verschiedenen Fertigungsstufen wurden immer wieder Klangtests durchgeführt. Entgegen anfänglicher Erwartung konnte dabei keine wesentliche Veränderung des Klangverhaltens festgestellt werden. Die große Scheibe allein schwingt relativ breitbandig und abhängig vom Anschlagpunkt beim Schlagen mit einem trockenen Buchenholzstab bei ca. 2500−2800 Hz mit immerhin fast 90 dB(A), die kleinen Scheiben schwingen einzeln bei ca. 3200−3500 Hz mit etwa 70 dB(A). Das etwas dünnere und leichtere Original sollte ca. 150−200 Hz heller geklungen haben. Musikalisch entspräche dies etwa der Notation: e‘‘‘‘−f‘‘‘‘ bzw. g‘‘‘‘. Im Zusammenspiel der Komponenten ergibt sich ein sehr eigenes Klangverhalten: Die Töne vermischen sich zu einem wohl etwas scheppernden, doch höchst imposanten Läuten. Im Feldversuch fand St. Michelbacher heraus, dass die Lautstärke der Replik bei nahezu Windstille ausreicht, um noch in 250 m Entfernung gehört zu werden.

Bis heute sind neun vollständige Tintinnabula bekannt; davon sind keine zwei formgleich. Umso interessanter ist deshalb, dass fast alle Instrumente dem gleiche Grundaufbau folgen: Sie bestehen aus einer großen und zwei kleinen, mit konzentrische Rillen verzierten Ringscheiben. Fast immer ist der großen Scheibe auf der 6-Uhr-Position ein rundes „Fensterloch“ zu eigen. Rundgestalt, Rillenzier und Fensterloch haben mit der Klangfunktion eigentlich nichts zu tun. Waren die Tintinnabula vielleicht mehr als bloße Klangerzeuger?
Damit stellt sich die Frage, in welchem kulturellen Zusammenhang das Tintinnabulum gegen Ende der Bronzezeit erklungen ist. War es nur ein Musikinstrument aus der Klasse der Schüttelidiophone, mit dem der Takt gegeben wurde, während Blasinstrumente die Melodie spielten? Oder war es vielleicht ein akustischer Signalgeber bei religiösen, politischen oder militärischen Veranstaltungen? Sicher war es keine Rassel, mit der Kinder spielten.
Tintinnabula oder Teile davon fanden sich nicht in Gräbern oder Siedlungen. Vom Atlantik bis ins Rhein-Main-Gebiet kennen wir sie hauptsächlich aus Hortfunden, die oftmals außer dem Klangblech einerseits Pferdegeschirr- und Wagenbronzen, Waffen und Werkzeug enthalten, andererseits eine Anzahl bronzener Arm- und Beinringe. Die Wiederholung des Ausstattungsmusters an weit entfernten Orten erweist diese Deponierungen als materiellen Niederschlag standardisierter Handlungen. Wir sehen darin ein Argument für einen rituellen Gebrauch der spätbronzezeitlichen Tintinnabula bei Zeremonien, die von der Pferde besitzenden, Wagen fahrenden, mit Arm- und Beinringen geschmückten Elite geleitet wurden. Mit dem Abtreten dieser Elite oder einzelner ihrer Akteure am Ende der Bronzezeit wurde deren Ausrüstung geopfert. Den Nachbau aber des Wallerfanger Tintinnabulum kann man im Historischen Museum Wallerfangen nicht nur anschauen, sondern zur Hand nehmen und selbst ausprobieren, wie die Bronzezeit geklungen hat.
| von Stefan Michelbacher und Rudolf Echt

An diesem Frequenzmessplatz mit einem HF-Messgerät zur indirekten Referenzmessung durch Ausblendungsverfahren wurde der durch Direktmessung mit HF-Messprogramm (Audiotool Sequenzer) ermittelte Frequenzgang der großen und kleinen Scheiben des Wallerfanger Tintinnabulums bestätigt. Foto Stefan Michelbacher. 
Ausgewählte Fundstücke aus dem Hort von Wallerfangen im Musée d’Archéologie Nationale. Foto Jean-Gilles Berizzi, Musée d’Archéologie Nationale.
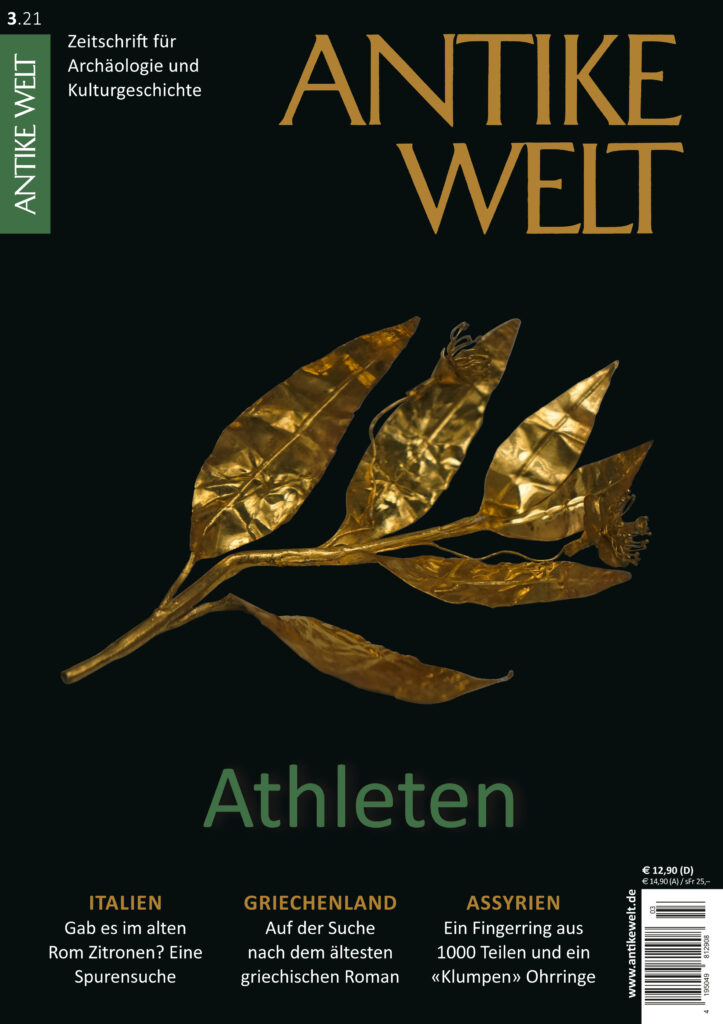
Das könnte Sie auch interessieren:
Klangbilder – Ein Ausstellungsprojekt der Archäologischen Sammlungen auf der Museumsinsel zur Musik in der Antike
Um verschiedene Aspekte von Musik in den antiken Kulturen zu beleuchten, kooperieren das Ägyptische Museum und Papyrussammlung, die Antikensammlung, das Vorderasiatische Museum und das Museum für Vor- und Frühgeschichte der Staatlichen Museen zu Berlin in einem gemeinsamen Ausstellungsprojekt an mehreren Standorten auf der Museumsinsel.
Fast 80 Jahre nach ihrer Entdeckung wurde eine große Tritonschnecke aus der Marsoulas-Höhle in den Pyrenäen von einem multidisziplinären Team des CNRS, des Muséum de Toulouse, der Université Toulouse – Jean Jaurès und des Musée du quai Branly – Jacques-Chirac untersucht: Sie gilt als das älteste Blasinstrument ihrer Art.

